„Hoffnung öffnet unsere Augen für das, was kommen wird“: Byung-Chul Han

EL TIEMPO veröffentlicht einen Teil des Vorspiels zum neuesten Buch des in Deutschland geborenen südkoreanischen Philosophen Byung-Chul Han, „Der Geist der Hoffnung“ (Herder, 2024), der kürzlich mit dem Prinzessin-von-Asturien-Preis für Kommunikation und Geisteswissenschaften ausgezeichnet wurde.
Das Gespenst der Angst lauert. Wir sind ständig mit apokalyptischen Szenarien wie Pandemien, Weltkriegen oder Klimakatastrophen konfrontiert: Katastrophen, die uns immer wieder an das Ende der Welt oder das Ende der menschlichen Zivilisation denken lassen. Im Jahr 2023 zeigte die Weltuntergangsuhr an, dass es noch neunzig Sekunden bis Mitternacht waren. Man sagt, dass der Minutenzeiger noch nie so nahe an der Zwölf gewesen sei.
Es scheint, als seien Apokalypsen in Mode. Sie werden jetzt verkauft, als wären sie Handelsware: Apokalypsen verkaufen sich. Und nicht nur im wirklichen Leben, sondern auch in der Literatur und im Film herrscht Weltuntergangsstimmung. In seiner Geschichte „The Silence“ erzählt Don DeLillo beispielsweise die Geschichte eines totalen Blackouts. Auch in zahlreichen literarischen Werken wird von steigenden Temperaturen und einem Anstieg des Meeresspiegels gesprochen. Als neues literarisches Genre hat sich Climate Fiction bereits etabliert. Ein weiteres Beispiel: T. C. Boyles Roman „Ein Freund der Erde“ erzählt von einem Klimawandel apokalyptischen Ausmaßes.
Wir leiden unter einer Mehrfachkrise. Wir blicken besorgt in eine düstere Zukunft. Wir haben die Hoffnung verloren. Wir geraten von einer Krise zur nächsten, von einer Katastrophe zur nächsten, von einem Problem zum nächsten. Angesichts der vielen zu lösenden Probleme und der vielen zu bewältigenden Krisen beschränkt sich das Leben nun aufs Überleben. Die keuchende Überlebensgesellschaft gleicht einem Kranken, der mit allen Mitteln versucht, dem drohenden Tod zu entgehen. In einer solchen Situation gibt es nur Hoffnung, die uns die Möglichkeit gibt, ein Leben zurückzugewinnen, in dem Leben mehr ist als bloßes Überleben. Es entfaltet einen ganzen Sinnhorizont, der das Leben wiederbeleben und fördern kann. Sie schenkt uns die Zukunft.
Es hat sich ein Klima der Angst ausgebreitet, das jede Spur von Hoffnung zunichte macht. Angst schafft ein depressives Klima. Gefühle der Angst und des Grolls treiben die Menschen dazu, sich dem Rechtspopulismus anzuschließen. Sie schüren Hass. Sie führen zu einem Verlust an Solidarität, Herzlichkeit und Empathie. Der Anstieg von Angst und Ressentiments führt zur Brutalisierung der gesamten Gesellschaft und wird letztlich zu einer Bedrohung für die Demokratie. Der scheidende US-Präsident Barack Obama sagte in seiner Abschiedsrede zu Recht: „ Die Demokratie kann zusammenbrechen, wenn wir der Angst nachgeben.“ Demokratie ist mit Angst unvereinbar. Sie kann nur in einer Atmosphäre der Versöhnung und des Dialogs gedeihen. Wer seine Meinung verabsolutiert und nicht auf andere hört, hat aufgehört, Bürger zu sein.
Demokratie ist mit Angst unvereinbar. Sie kann nur in einer Atmosphäre der Versöhnung und des Dialogs gedeihen.
Angst war schon immer ein hervorragendes Instrument der Herrschaft. Es macht die Menschen gefügig und leicht erpressbar. In einem Klima der Angst wagen die Menschen es nicht, ihre Meinung frei zu äußern, aus Angst vor Repressionen. Hassreden und digitale Lynchmorde schüren offensichtlich den Hass und verhindern die freie Meinungsäußerung . Heute haben wir sogar Angst zu denken. Es scheint, als hätten wir den Mut zum Denken verloren. Und doch glaubt man, dass, wenn es empathisch wird, die Türen zu etwas völlig anderem geöffnet werden. Wenn die Angst herrscht, dürfen Unterschiede nicht offengelegt werden und es kommt nur zu einer Fortsetzung des Gleichen. Es herrscht Konformität. Angst verschließt die Türen zu dem, was anders ist. Der Logik der Effizienz und Produktivität, die eine Logik der Gleichheit ist, sind Unterschiede nicht zugänglich.
Wo Angst herrscht, ist Freiheit unmöglich. Angst und Freiheit sind unvereinbar. Angst kann eine ganze Gesellschaft in ein Gefängnis verwandeln, sie kann sie unter Quarantäne stellen. Angst installiert lediglich Warnsignale. Hoffnung hingegen hinterlässt Hinweise und Wegweiser. Hoffnung ist das Einzige, was uns dazu bringt, unsere Reise anzutreten. Sie gibt uns Sinn und Richtung, während die Angst es uns unmöglich macht, vorwärts zu kommen.
Heute haben wir nicht nur Angst vor Viren und Kriegen; Auch die Klimaangst beunruhigt die Menschen. Klimaaktivisten geben zu, „Angst vor der Zukunft“ zu haben. Angst raubt ihnen ihre Zukunft. Es besteht kein Zweifel, dass es Gründe gibt, „Angst vor dem Klima“ zu haben. das ist unbestreitbar. Doch was wirklich Besorgnis erregt, ist die Ausbreitung eines Klimas der Angst. Das Problem ist nicht die Angst vor der Pandemie, sondern die Pandemie der Angst. Dinge, die aus Angst getan werden, sind keine zukunftsorientierten Handlungen. Handlungen brauchen einen Sinnhorizont. Sie müssen erzählbar sein. Hoffnung ist beredt; erzählt. Im Gegenteil: Der Sprache wird die Angst abgesprochen, sie ist unfähig zu erzählen.
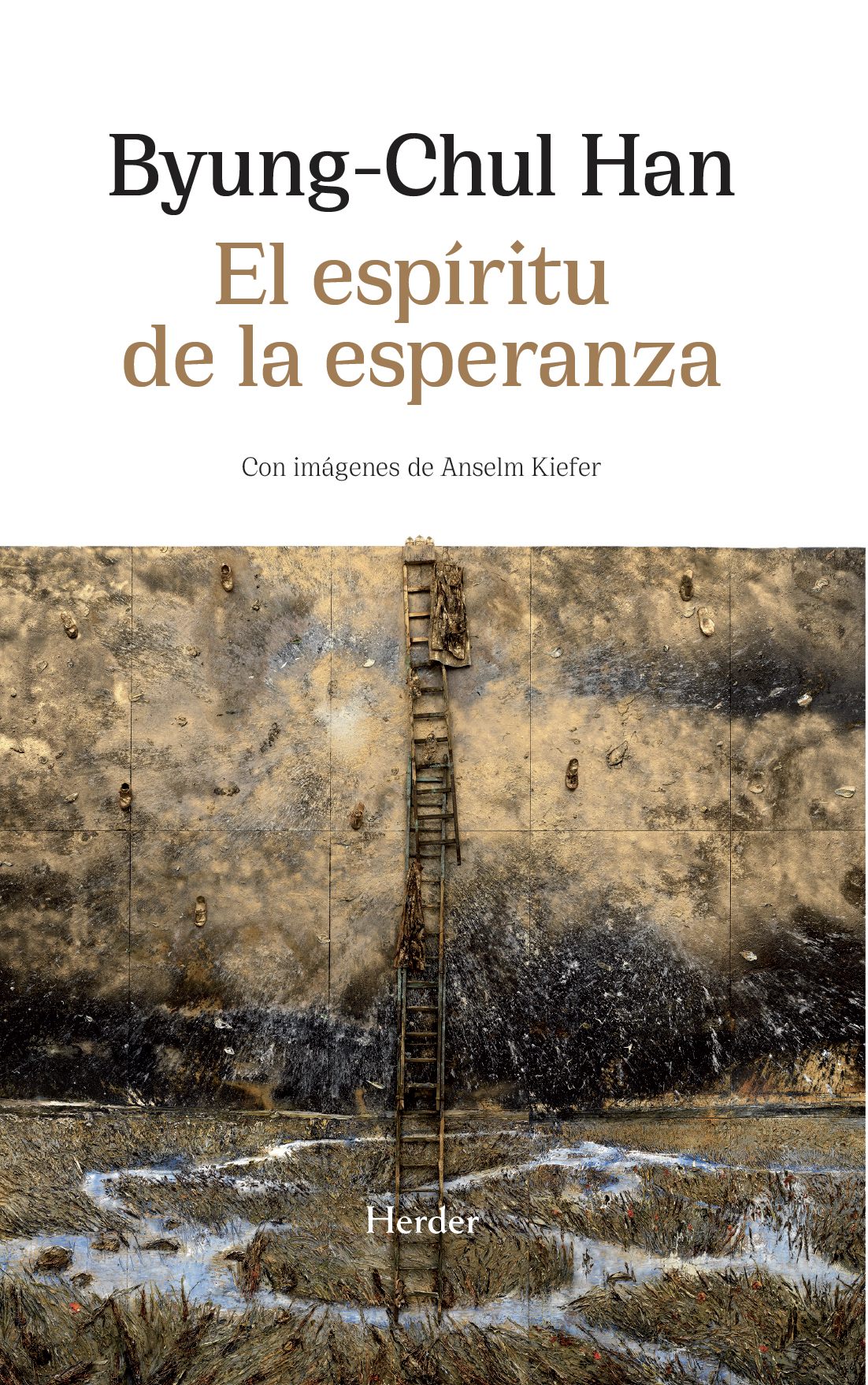
Herder Editorial / Erstausgabe / 2024 / Vertrieb durch Siglo Foto: Herder Editorial
Angustia (mittelhochdeutsch angest , althochdeutsch angust ) bedeutet ursprünglich, wie im Lateinischen, ‚Enge‘. Durch die Einengung und Blockierung der Sicht erstickt die Angst jede Weite und jede Perspektive. Wer verzweifelt ist, fühlt sich in die Enge getrieben. Angst bringt ein Gefühl der Gefangenschaft und Beengtheit mit sich. Wenn wir verzweifelt sind, erscheint uns die Welt wie ein Gefängnis. Wir haben alle Türen geschlossen, die uns nach draußen führen würden. Angst verhindert die Zukunft und verschließt die Türen zu dem, was möglich ist, zu dem, was neu ist.
Der Etymologie des Begriffs zufolge ist Hoffnung das Gegenteil von Angst. Friedrich Kluges etymologisches Wörterbuch erklärt das Wort hoffen wie folgt: „Wenn man weiter sehen will oder besser sehen will, streckt man sich nach vorne.“ Hoffnung bedeutet daher „in die Ferne blicken, in die Zukunft blicken“. Hoffnung öffnet unsere Augen für das, was kommen wird. Das Verb „ verhoffen “ hat immer noch die ursprüngliche Bedeutung „warten“ oder „hoffen“ . Im Jägerjargon bedeutet es „Wild mit Hilfe des Windes untersuchen oder verfolgen“, also stehen bleiben, um zu lauschen, sich anzupirschen oder zu schnüffeln. Deshalb heißt es: „Der Hund nimmt den Wind.“ Wer wartet, „nimmt den Wind“, das heißt, er schaut, wo er stehen und welche Richtung er einschlagen soll.
Aus der tiefsten Verzweiflung entsteht die innigste Hoffnung. Je tiefer die Verzweiflung, desto stärker die Hoffnung. Es ist kein Zufall, dass in der griechischen Mythologie Elpis, die Göttin der Hoffnung, die Tochter von Nyx, der Göttin der Nacht, ist. Elpis' Brüder sind Tartarus und Erebus (die Götter der Dunkelheit und der Schatten), und ihre Schwester ist Eris. Elpis und Eris sind eine Familie. Hoffnung ist eine dialektische Figur. Die Negativität der Verzweiflung ist konstitutiv für die Hoffnung. Auch der heilige Paulus betont, dass der Hoffnung Negativität innewohnt:
Wir freuen uns auch über unser Leid, denn wir wissen, dass uns das Leid die Kraft gibt, durchzuhalten, und diese Kraft verschafft uns Gottes Anerkennung. Und Gottes Anerkennung gibt uns Hoffnung, eine Hoffnung, die niemals enttäuscht.
Verzweiflung und Hoffnung sind wie Tal und Berg. Die Negativität der Verzweiflung ist der Hoffnung inhärent. So erklärt Nietzsche die dialektische Beziehung zwischen Hoffnung und Verzweiflung:
„Hoffnung ist ein Regenbogen, der sich über der Quelle des Lebens entfaltet, die in einer schwindelerregenden Kaskade herabstürzt; ein Regenbogen, der hundertmal vom schäumenden Wasser verschluckt und hundertmal neu erschaffen wird und der sich mit zarter und schöner Kühnheit über den Strom erhebt, wo sein Tosen am wildesten und gefährlichsten ist.“
Es gibt keine treffendere Beschreibung von Hoffnung. Sie besitzt eine zarte und schöne Kühnheit. Wer Hoffnung hat, handelt mutig und lässt sich von den Härten und Härten des Lebens nicht beirren. Gleichzeitig hat die Hoffnung etwas Besinnliches. Er streckt sich nach vorne und spitzt die Ohren. Es besitzt die Zartheit der Empfänglichkeit, die ihm Schönheit und Charme verleiht.
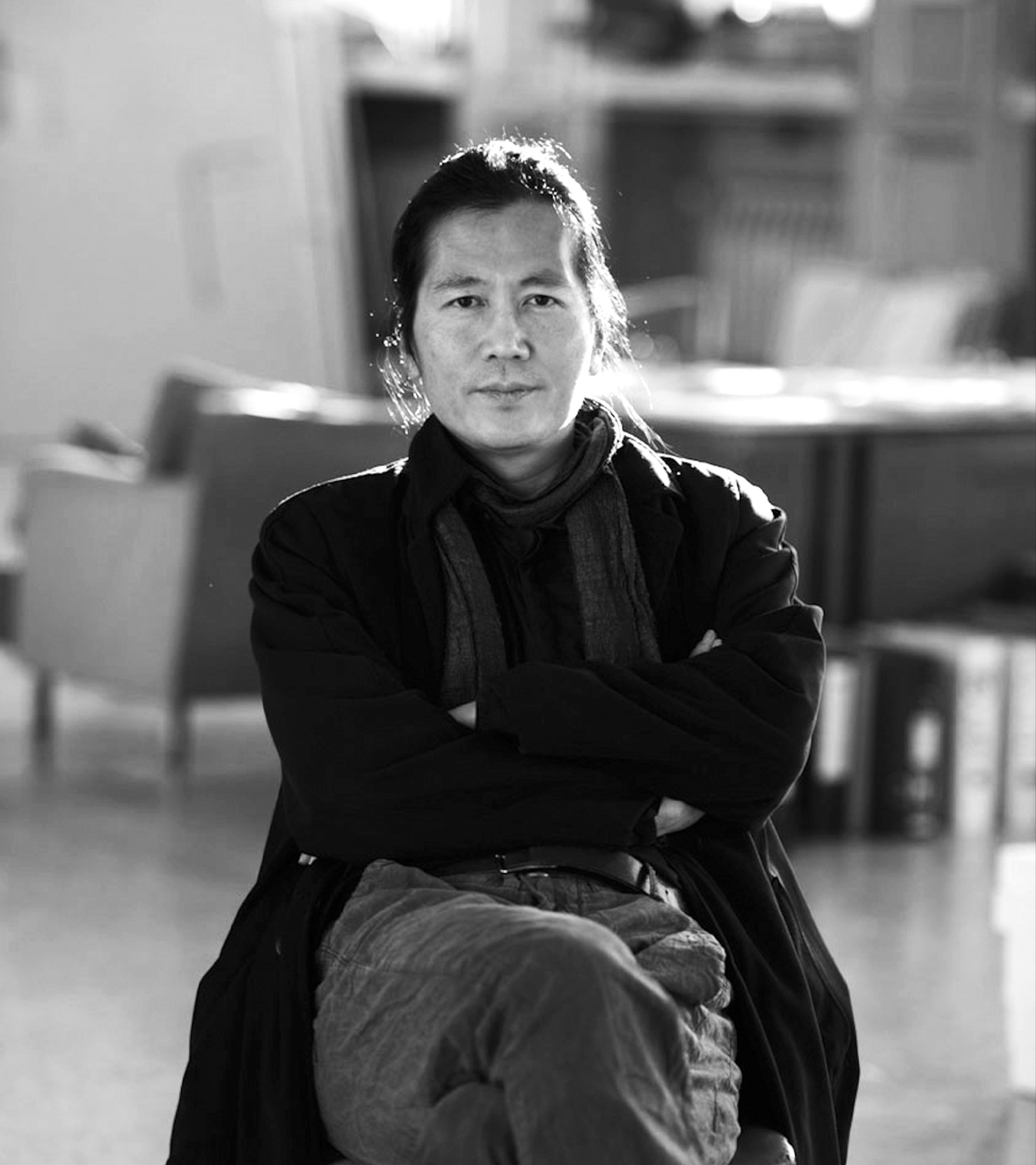
Han studierte Deutsche Literatur und Theologie an der Universität München und Philosophie an der Universität Freiburg. Foto: Herder Redaktion
Für die Jury des Prinzessin-von-Asturien-Preises hat der deutsche Philosoph und Essayist südkoreanischer Herkunft Byung-Chul Han die Herausforderungen der technologischen Gesellschaft brillant interpretiert und durch seine Arbeit eine außergewöhnliche Fähigkeit bewiesen, präzise und direkt „neue Ideen zu kommunizieren, die sich auf philosophische Traditionen aus Ost und West stützen.“
Auch im Jurybericht wird Hans Analyse als „äußerst fruchtbar“ hervorgehoben, „und sie bietet Einblicke in Themen wie Entmenschlichung , Digitalisierung und die Isolation des Einzelnen.“
Er ist Autor von mehr als einem Dutzend Titeln wie „The Society of Fatigue“ (2010), „The Society of Transparency“ (2012), „The Salvation of Beauty“ (2015) und „The Disappearance of Rituals“ (2020). In seinen jüngsten Werken hat er seinen kritischen Ansatz zur heutigen Gesellschaft erweitert und Überlegungen zu Hoffnung und Kontemplation einbezogen.
Han hat seine Karriere als Essayist mit einer Lehrtätigkeit an einer Universität in Deutschland kombiniert, wo er an der Universität München Deutsche Literatur und Theologie studierte. Er arbeitete von 2000 bis 2012 an der Universität Basel (Schweiz) und war Professor für Philosophie und Kulturwissenschaften an der Universität der Künste Berlin , nachdem er zuvor als Professor an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe tätig war.
Der südkoreanische Denker, der behauptet, unser Leben sei von Hypertransparenz, Hyperkonsumismus, einem Übermaß an Informationen und einer Positivität durchdrungen, die unweigerlich zu einer Gesellschaft der Ermüdung führe, hat kein Smartphone und geht nicht auf Sightseeing-Tour . Er hört analoge Musik und widmet einen Teil seiner Zeit der Pflege seines Gartens – alles in dem Versuch, gegen den Kapitalismus zu rebellieren, den er in seiner Arbeit scharf kritisiert. Seiner Meinung nach hat die Gesellschaft Reflexion, Rückzug und Meditation aufgegeben und schätzt daher Individualität nicht.
eltiempo

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F9b9%2Fbb0%2Fa5a%2F9b9bb0a5a63c812b26632d8c5b554d73.jpg&w=3840&q=100)


