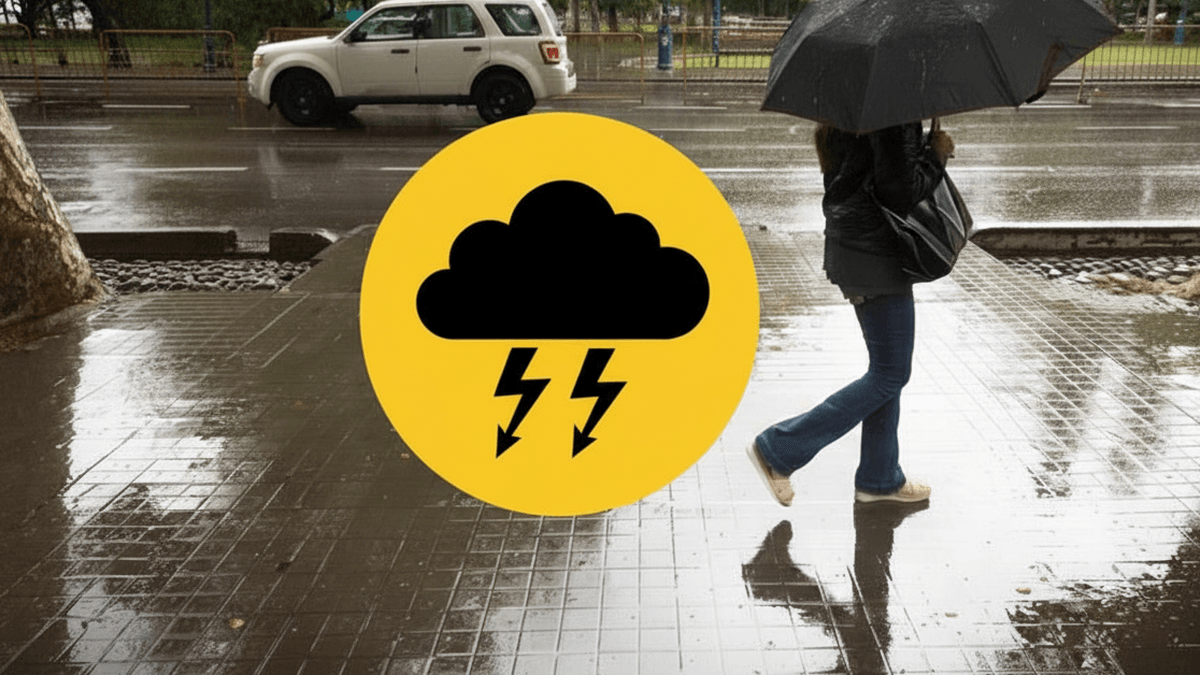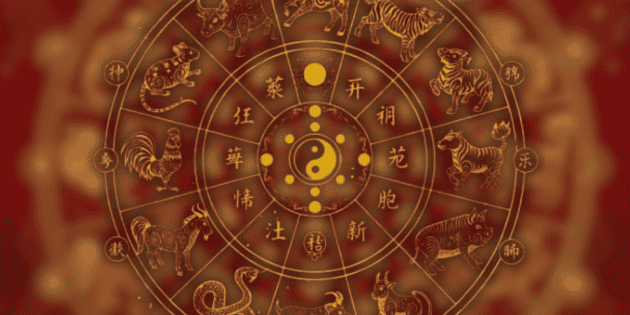Die transatlantische Reise von mehr als 400 mexikanischen Kunstwerken, die der Versöhnung mit Spanien dienten.

In einem Wettlauf gegen die Zeit von nur acht Monaten ist es den beiden Ländern gelungen, vier Ausstellungen zu organisieren, die das Erbe indigener Frauen würdigen.

Am Freitag um 8:30 Uhr startete vor dem imposanten Altar zum Tag der Toten in der Casa de México in Madrid eine Bustour durch vier Kulturinstitutionen, um in weniger als vier Stunden die über 400 präkolumbischen Kunstwerke der in Kapitel unterteilten Ausstellung zu entdecken. Die Hälfte der Welt: Frauen im indigenen Mexiko . Schon der Titel der Veranstaltung ließ erahnen, dass es sich hier nicht nur um eine gewöhnliche Ausstellung handelte. Nach 14 Uhr wurde deutlich, dass diese Hunderte von Kunstwerken, die das uralte Erbe der indigenen Völker würdigen , eine Bedeutung besaßen, die weit über das rein Künstlerische hinausging.
„Die gemeinsame Geschichte Spaniens und Mexikos hat, wie die gesamte Menschheitsgeschichte, ihre hellen und dunklen Seiten. Es gab Leid und Unrecht gegenüber den indigenen Völkern. Es gab Unrecht, und es ist nur recht und billig, dies anzuerkennen und zu beklagen. Das ist Teil unserer gemeinsamen Geschichte; wir können es weder leugnen noch vergessen“, sagte der spanische Außenminister José Manuel Albares bei der Schließung der Ausstellung. Die spanische Regierung unternahm damit den bedeutendsten Schritt zur Annäherung der beiden Länder , nachdem die Beziehungen eingefroren waren, als der ehemalige Präsident Andrés Manuel López Obrador 2019 vom König eine Entschuldigung für die Gräueltaten der Eroberung forderte.
Der Wettlauf gegen die Zeit, um die Ausstellung am 31. Oktober zu eröffnen, begann Ende 2024 mit ersten Kontakten zwischen den beiden Ländern in Mexiko während der Internationalen Buchmesse in Guadalajara, wo Spanien Ehrengast war. Monate später, im Februar, und nach der vorherigen Genehmigung der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum für die Leihgabe aller Kunstwerke, begann die Planung unter der Leitung der Kuratorin Karina Romero. Dutzende Kultur- und Regierungsinstitutionen beider Länder waren daran beteiligt. Ausstellungen dieser Art werden üblicherweise mindestens zwei Jahre im Voraus organisiert. In diesem Fall dauerte es etwa acht Monate.
Die Kunstwerke trafen am vergangenen Mittwoch, dem 22. Oktober, in Madrid ein und wurden auf das Thyssen-Museum, das Nationale Archäologische Museum und das Cervantes-Institut verteilt. Der Bereich im Casa de México war bereits am 8. Oktober eröffnet worden. Laut Angaben des Kulturministeriums mussten Spanien und Mexiko erstmals ein spezielles EU-Importsystem nutzen, um die pünktliche und reibungslose Ankunft der Kunstwerke zu gewährleisten.
Dies ist eine Übersicht der vier Ausstellungen, die bis März 2026 besucht werden können.
Die Ausstellung „Das göttliche Reich“ in der Casa de México Stiftung in Spanien ist noch bis zum 15. Februar zu sehen.
Diese Ausstellung bietet einen tiefgründigen Einblick in Spiritualität und weibliche Ritualpraktiken. „Wir haben 98 Objekte ausgewählt, die stets zwei Seiten zeigen: das Männliche und das Weibliche, Tag und Nacht, Trockenheit und Feuchtigkeit. Im indigenen Denken werden diese Konzepte nicht binär, sondern als komplementäre Gegensätze verstanden, die die Weltanschauung indigener Völker prägen“, erklärte Kuratorin Karina Romero.
Ein Teil der Ausstellung ist der weiblichen Heiligkeit gewidmet, dargestellt durch die Figuren verschiedener Göttinnen, die mit Fruchtbarkeit, Schöpfung und Zerstörung in Verbindung gebracht werden. Nach der Eroberung, so Romero, wurden viele dieser Gottheiten als Anrufungen der christlichen Jungfrau Maria neu interpretiert. Um den kulturellen Widerstand gegen diese Vereinnahmung zu veranschaulichen, wurde die Figur der Jungfrau von Guadalupe einer religiösen Skulptur gegenübergestellt. Beide tragen denselben Mantel, der, wie der Experte erklärte, „die Kontinuität dieser lebendigen, sich entwickelnden Völker“ symbolisiert.
Lady Tz'aka'ab Ajaw. Die Rote Königin von Palenque, bis zum 22. März im Nationalmuseum Thyssen-Bornemisza
Romero und Juan Manuel Garibay, der Ausstellungsarchitekt des Museums, besichtigten verschiedene Orte auf der Suche nach dem idealen Ausstellungsort für die Grabbeigaben der Roten Königin , einer bedeutenden Maya-Würdenträgerin aus dem 7. Jahrhundert – ein Beispiel für die Macht und den Einfluss, den Frauen in den herrschenden Eliten erlangten. Sie kamen im Thyssen-Museum in Madrid an , und in einem der Räume im zweiten Stock, angrenzend an die ständige Sammlung, entdeckten sie an der Decke ein Gewölbe, das sie, wie sie sagen, an das Grabmal der Herrscherin erinnerte. „Wir sagten zueinander: ‚Das ist ein Zeichen, es muss hierher‘“, erinnerten sich die beiden Experten für mexikanische Kunst.
In einer Vitrine wurde der Leichnam der Roten Königin so rekonstruiert, dass der Kopfschmuck, die Totenmaske und der Schmuck, die vor 20 Jahren bei der Entdeckung der Überreste von Palenque gefunden wurden, auf ihrem Kopf, Gesicht und ihrer Brust platziert werden können. Die Überreste waren mit Zinnober bedeckt, einem intensiv roten Pulver, das Leben und Erneuerung symbolisierte und in ihre Knochen eingedrungen war.
Die menschliche Sphäre im Nationalen Archäologischen Museum
Die Ausstellung möchte den Alltag beleuchten und aufzeigen, wie Frauen im Rahmen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung wesentliche Rollen übernahmen: Kindererziehung, Altenpflege, Textil- und Keramikherstellung, Essenszubereitung sowie die Weitergabe von rituellen und gemeinschaftlichen Kenntnissen. Sie will außerdem verdeutlichen, wie diese Tätigkeiten den sozialen Zusammenhalt und die Identität dieser Gemeinschaften stärkten.
Bislang sind erst zwei Räume vollständig eingerichtet. Die Ausstellung wird am 2. Dezember im Hauptausstellungsort dieser Initiative eröffnet und präsentiert über 200 Werke auf 600 Quadratmetern. Angesichts der Vielzahl der Arbeiten und der Auseinandersetzung mit verschiedenen Facetten des Privatlebens vermittelt dieses Kapitel wohl am umfassendsten die Botschaft, mit der diese Initiative nach Spanien kommt: „Die ständige und vielschichtige Präsenz indigener Frauen wiederzuentdecken, deren Erbe die Erinnerung, die Sprache und die Traditionen bewahrt, die den kulturellen Reichtum Mexikos ausmachen“, so Romero.
Die Ausstellung „Gewebte Geschichten“ im Cervantes-Institut ist noch bis zum 8. März zu sehen.
„Im Cervantes-Institut verstehen wir diese Ausstellung als Metapher für unsere eigene Arbeit: Wir weben eine gemeinsame Sprache aus unterschiedlichen Stimmen und teilen und projizieren unsere Traditionen in die Zukunft“, sagte García Montero, Direktorin des Instituts, bei der Ausstellungseröffnung. „Seit vorspanischer Zeit sind Spinnen, Weben und Sticken Frauensache“, bemerkte Kuratorin Karina Romero.
In der Eingangshalle des Cervantes-Instituts werden Textilkunstwerke ausgestellt, die veranschaulichen, wie wertvoll das Erlernen dieser Muster und Techniken ist – genauso wertvoll wie das Erlernen der Sprache von Kindesbeinen an. „Mädchen lernen durch Beobachtung und Übung unter der Anleitung ihrer Mütter und Großmütter. Mit der Zeit beherrschen sie die Wörter, die Muster, die Symbole und die Techniken und werden so zu Trägerinnen eines sowohl materiellen als auch spirituellen Wissens“, erklärte Romero.
EL PAÍS