Marco Martella und die Gartenleute


Reicht es aus, irgendwo Bäume zu pflanzen, um das Leben als einfach zu begreifen? Marco Martella weiß, dass das Land, anders als die „Stadtmenschen“ denken, nie ein angenehmer Ort war. Für den Autor von „Eine kleine Welt , eine perfekte Welt“ gedeihen Spaziergänge und Neugier in seinem unklassifizierbaren Essay-Genre, das Recherche und Fantasie verbindet.
Samuel Beckett und Violet Trefusis , Pasolini und seine französische Nachbarin Suzanne, Anemonen und Myrobolan-Pflaumenbäume … sie teilen sein neues Buch „The Fruits of Myrobolan“ (Elba Editorial). „Manche Menschen scheinen, wie manche Arten, so zu wachsen, als könne die Wahrheit nur inmitten von Lügen gedeihen“, bemerkt er.
Eine Wahrheit könnte Becketts eintöniges Leben in Ussy (Frankreich) sein, in dem Haus, in dem ein Schuljunge mit perfekt gemähtem Rasen und Apfelbaum zeichnete, wo er umsonst Texte schrieb und in der Abenddämmerung billigen Weißwein trank. Martella erzählt, dass ein Schüler, der dorthin kam, Beckett fragte, ob er Beckett sei, und er antwortete: „Entschuldigen Sie, ich bin nur der Gärtner.“ Als er ans Telefon ging, gab sich Elias Cannetti als sein Sekretär aus. Was wäre ich, wenn ich es sein könnte?
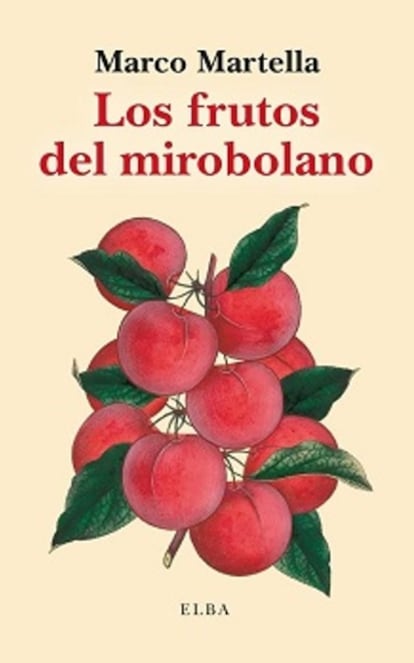
In ihrem neuen Buch taucht Martella in die Gärten der „Priester“ ein, ein Zeitvertreib der Reichen, denn, wie ihre Nachbarin Suzanne ihr sagt, „die Freude am erfolgreichen Säen ist nichts weiter als ein Ersatz für die wahren Freuden des Lebens.“ Ein Leben, das vergeht, ohne Früchte zu tragen, ist kein wahres Leben, glaubt die Dame. Aber was ist Frucht?, fragt sich Martella. Wie hatte Suzanne es geschafft, die Schönheit dieser Pflanzen zu steigern, wenn der Saft nicht mehr durch ihre Adern floss?
So wie es Wege gibt, die nirgendwohin führen, so gibt es auch Samen, die darauf warten, zu blühen, und Bücher, die darauf warten, geschrieben zu werden. Die seltsamen Früchte des Trostes, auf die Rilke anspielt, sind für Martella die schönsten. Deshalb wachsen Anemonen nur in Böden, in denen abgestorbene Blätter und Holz beim Zersetzen allmählich eine tiefe, feuchte Erde bilden.
Der Autor von Fleurs (Elba) schreibt, dass Häuser, wie Wälder, ihre Geräusche haben. Dass es Zeit braucht, sich an sie zu gewöhnen. Und er spricht von der Stille, die ebenfalls wie Blumen blüht. So beschwört er den armen Baucis herauf, der sich in eine Eiche verwandelt, und Philemon, der sich nun in eine Linde verwandelt hat. Martella verwendet diese Worte, um den römischen Mythos von den Menschen zu beschreiben, die von Bäumen abstammen und „von ihrem Adel erschlagen wurden“.
„Wer Gärten liebt, gibt sich nicht mit dem Leben zufrieden. Er glaubt, es sei gut, den Tod zu erforschen, um ihn zu zähmen. Er weiß, dass ein Garten Last und Freude zugleich ist.“ Ihnen gegenüber verteidigt Martella den unbedeutenden Garten. Montaignes unvollkommenen Garten, in dem der französische Essayist hoffte, der Tod würde ihn überraschen, indem er Kohl pflanzte. Ist es das? Pflanzen ist ein heiliger Akt. Ein Akt des Glaubens. Warum immer weiter pflanzen? „Ehrlich gesagt, habe ich nie gewusst, warum ich gepflanzt habe“, erklärt Martella selbst. Er ist …, so scheint es, ein Bauer, der gelernt hat, das Leben mit Geduld zu ertragen. Und zu akzeptieren, nicht zu wissen, was morgen passieren wird.
EL PAÍS


%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F7a7%2Fd6d%2F714%2F7a7d6d714ff6c65379762ca8c5fe17a0.jpg&w=3840&q=100)

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F440%2F4d4%2F8b7%2F4404d48b7d5b32a72f09801d7301b278.jpg&w=3840&q=100)
